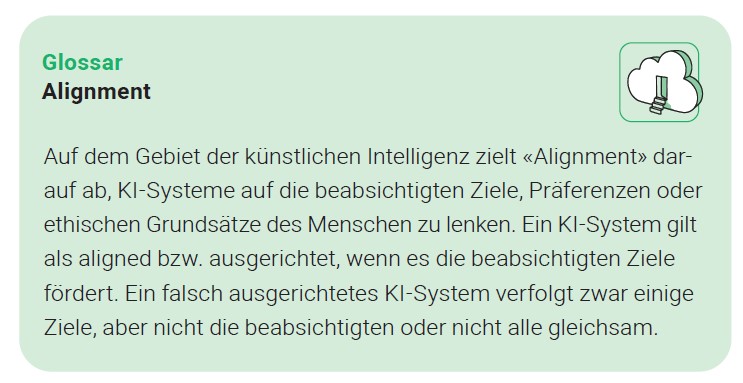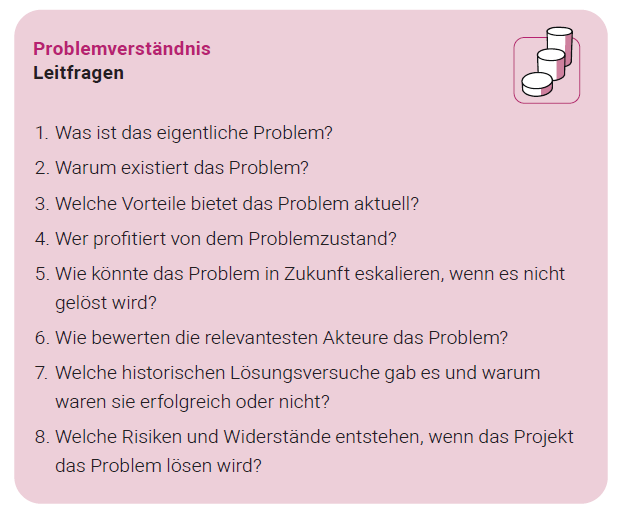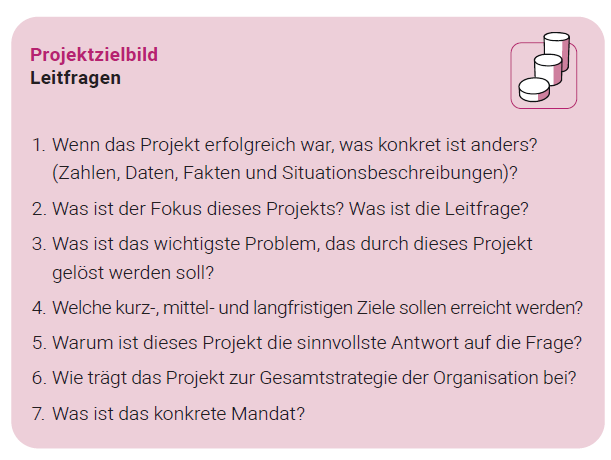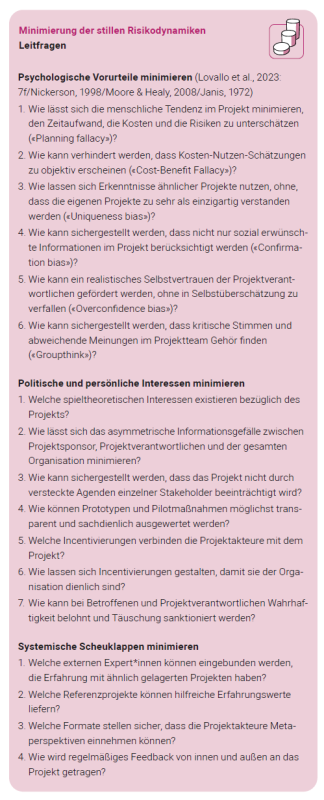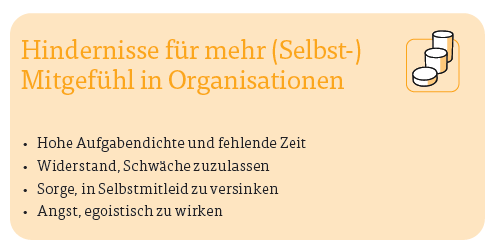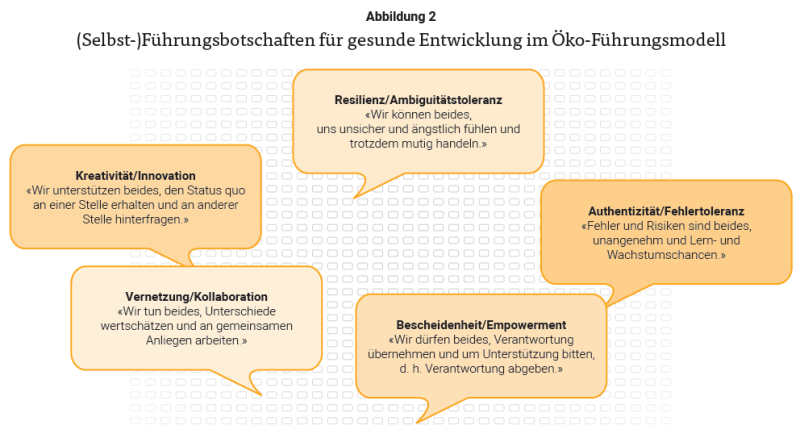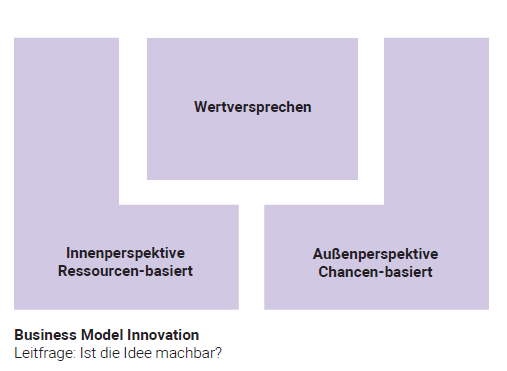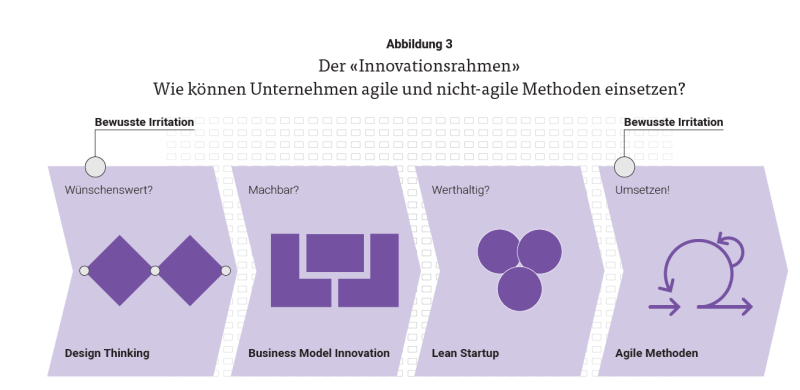Ab dem Moment, wo erste Gerüchte über eine bevorstehende Fusion, Übernahme oder Umstrukturierung durchs Haus wehen, ist nichts mehr wie es war. Über allen Projekten, Investitionen und Vorhaben schwebt plötzlich ein unsichtbares Verfallsdatum. Gleich ob der Tag, an dem die Neuerungen in Kraft treten, bereits fest terminiert ist oder unbestimmt in der Zukunft liegt: Der Status quo, den alle wie selbstverständlich ins Unendliche extrapoliert hatten, ist unwiderruflich dahin; ab sofort lebt man in einer Übergangszeit.
Das stellt sämtliche Zukunftsinvestitionen in Frage – nicht nur finanzielle, auch emotionale. Lohnt es sich überhaupt noch, so fragen sich die Mitwirkenden, Zeit und Kraft in ein laufendes Projekt zu stecken oder ist ungewiss, was daraus unter den veränderten Umständen werden wird? Die Frage zu stellen, heißt, sie zu beantworten. Also erlahmt die Energie, und Projekte schlafen entweder ein oder schleppen sich untot dahin.
Dieses «Abschlaffen» ist keineswegs voreilig und irrational, wie manche im Management schimpfen. Es ist völlig rational. Um sich für ein Vorhaben zu engagieren, muss man daran glauben, dass etwas daraus werden wird: Dass es etwas bringt, dass es die Welt, wenigstens die eigene kleine Welt oder Abteilung, ein Stückchen besser machen wird. Wenn man daran nicht mehr glauben kann, wäre es irrational, sich weiter zu engagieren. Also hören die Leute auf damit.
Durchhalteparolen
Oft gibt das Top-Management in dieser Situation die Parole aus: «Wir machen erst einmal weiter wie bisher, so als ob es keine Fusion, Übernahme oder Umstrukturierung gäbe. Mit guten Ergebnissen kann sich schließlich jede*r am besten für die bevorstehenden Entscheidungen positionieren.» Das klingt auf den ersten Blick einleuchtend und vernünftig – und ist auf den zweiten blanker Unsinn. Denn «wie bisher» gibt es nicht mehr: Der Schatten der Zukunft, wie es der Kooperationsforscher Robert Axelrod genannt hat, hat auf einen Schlag seine Gestalt verändert und ist zu einer dunklen, bedrohlichen Wolke geworden.
Trotzdem hat die Ansage Wirkung. Die Adressaten verstehen sie – richtigerweise – so, dass das Management von ihnen erwartet, so zu tun als ob nichts wäre. Und zumindest bei offiziellen Anlässen keine insistierenden Fragen zu stellen. Was ihre Sorgen und Ängste natürlich nicht beseitigt, sondern nur in den Untergrund drängt. Aber immerhin: Vordergründig herrscht Ruhe.
«Man hört überhaupt nichts», wunderte sich eine Personalchefin. «Ich frage mich, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.» Naja, es ist das eigene Echo: Man sagt ja auch nichts.
Jede*r kämpft für sich alleine
Die Beschäftigten entnehmen der Weiter-so-Ansage vor allem eines: Von ihren Vorgesetzten ist in dieser Angelegenheit keine Hilfe zu erwarten. Jede*r kämpft für sich alleine. Also tun alle wie geheißen und simulieren Normalität. Die eine recherchiert schon mal in Job-Portalen, der andere reaktiviert sein Netzwerk von der Uni. Der dritte gründet mit Mitbetroffenen eine Yammer-Gruppe. Die vierte überlegt, ob jetzt nicht der ideale Zeitpunkt wäre, noch ein zweites Kind zu bekommen. Der fünfte brütet, wie es seine Art ist, dumpf vor sich hin. Und natürlich stellt der Betriebsrat markante Forderungen, schon um die eigene Ratlosigkeit zu verdecken.
Nur für eines interessiert sich in dieser Situation kaum noch jemand, nämlich für die Kundschaft. Was deshalb gefährlich ist, weil das die Richtung ist, aus der das Geld kommt – allerdings nur, wenn zuvor eine halbwegs akzeptable Leistung erbracht wurde.
Halt, falsch, wir wollen nicht ungerecht sein: Für die Lieferanten interessiert sich auch keiner mehr. Auch für andere externe Stakeholder nicht. Nur der Webshop reagiert weiter mit stoischem Gleichmut auf eingehende Bestellungen. Allenfalls bei den Auslieferungen und bei Reklamationen kann es zu Ausfällen kommen, weil hier – Pech gehabt – wieder Menschen im Spiel sind.
Im Gegensatz zu anderen Arten besitzt der Mensch die Fähigkeit, sich über die Zukunft Gedanken – sprich, Sorgen – zu machen. Und er macht reichlich Gebrauch davon. Was kommen wird oder kommen könnte, quält die meisten Menschen mehr als die Widrigkeiten der Gegenwart. Befürchtetes Unheil kann eine im Grunde erträgliche Realität zur Hölle machen, bezeugte schon Michel de Montaigne: «Mein ganzes Leben war geprägt von Katastrophen, von denen die allermeisten nie eingetreten sind.»
Wegen dieser «Ausnahmebegabung zum Vorausfürchten» tun sich Menschen sehr schwer damit, mit Übergangssituationen zu leben. Sobald klar ist, dass sich die Lage ab einem bestimmten (oder unbestimmten) Termin grundlegend ändern wird, ist die Gegenwart im Grunde vorbei – man befindet sich mental im Wartezimmer. Und je bedrohlicher die Schatten der Zukunft erscheinen, desto mehr verklären viele die Gegenwart, an der sie noch bis vor kurzem ziemlich viel auszusetzen hatten.
Zwar hat Morgan Housel wahrscheinlich recht, wenn er sagt: «A big takeaway from economic history is that the past wasn’t as good as you remember, the present isn’t as bad as you think, and the future will be better than you anticipate.» Aber es ist schwer, sich an solchen Weisheiten aufzurichten, wenn der Schatten der Zukunft so dunkel und bedrohlich wirkt.
Lahme Enten
Was können Führungskräfte, was kann das Top-Management in solch einer Situation tun, um Stress zu reduzieren und Ruhe und Zuversicht zu schaffen? Die schlechte Nachricht lautet: Nicht allzu viel. Ihre Einflussmöglichkeiten hängen zum Großteil von einem Faktor ab, der nicht in ihren Händen liegt: Ob sie nämlich selbst bereits einen festen Platz in der zukünftigen Struktur haben oder nicht. Auch hier ist der «Schatten der Zukunft» bestimmend: Jemand, der selbst (noch) keinen festen Platz in der künftigen Organisation hat, kann allenfalls Trost spenden, aber keine belastbaren Zusagen machen. Sie können die Ungewissheit nicht reduzieren, denn man kann mit ihnen keine verbindlichen Vereinbarungen treffen.
Für die Zusicherung «Falls ich Chefin dieses Bereichs werde/bleibe, werde ich Sie …» kann man sich nichts kaufen. Denn die unausgesprochene zweite Satzhälfte lautet: «Wenn nicht, dann nicht.» Eine solche Zusage beruhigt niemanden: Darauf kann man keine Lebens- oder Karriereplanung aufbauen. Auf ernüchternde Weise zeigt dies, wie dominierend in solchen Situationen die formale Autorität gegenüber der personalen
ist. Einfühlungsvermögen, «Leadership» und «Persönlichkeit» nützen nur sehr begrenzt, wenn man nicht die Macht hat, verbindliche Zusagen zu machen. Wer am Ertrinken ist (oder sich so fühlt), braucht nicht Empathie und Zuwendung, und er braucht erst recht keine «Leadership» – er braucht einen festen Halt.
Entlastung und Ermutigung
Daraus folgt nicht, dass Empathie, Persönlichkeit und innere Haltung in solchen Situationen überhaupt keine Rolle spielten. Natürlich ist es ein Unterschied, ob die ausgesprochene oder unausgesprochene Ansage lautet: «Wir simulieren jetzt Normalität!» oder ob sie heißt: «Ich weiß, wie belastend diese Situation für euch ist.» (Den unvermeidlichen Nachsatz, dass die Situation auch für einen selbst belastend ist, sollte man sich schenken: Er lenkt nur von den Betroffenen weg auf die eigene Person.)
Doch der Nutzen einfühlsamer Kommunikation ist begrenzt: Eine Sorge geht nicht davon weg, dass man sie würdigt. Da Führungskräfte Situationen der Ungewissheit nicht auflösen können, bleibt ihnen nur Schadensbegrenzung: Für etwas Entlastung zu sorgen, die Sache aber zumindest nicht mit dummen Sprüchen, die der Vereinzelung Vorschub leisten, noch schlimmer zu machen.
Für die meisten Beschäftigten können die Vorgesetzten, solange die Verhältnisse unklar sind, kaum mehr tun als ihnen zu signalisieren, dass sie um ihre Sorgen wissen. Es bringt nichts, Gesprächskreise zu gründen, in denen man sich über seine Gefühle austauscht. Wer solch einen Gesprächskreis sucht, findet ihn im Zweifel selbstorganisiert an der Kaffeemaschine.
Selbstorganisiert «emergiert» auch, dass viele ihren persönlichen «Plan B» machen: Sie denken darüber nach, was sie denn täten, falls die Firma ihnen entweder kündigte oder eine wenig attraktive Position anböte. Davon erfahren die Vorgesetzten in der Regel wenig; es findet entweder ganz im Stillen oder mit engsten Vertrauten statt: Man will ja nicht als unsicherer Kantonist erscheinen. Doch über Alternativen nachzudenken, ist vernünftig und gesund: Ein guter Plan B ist das beste Mittel gegen Ohnmachtsgefühle und Zukunftsängste.
Eine Nebenwirkung solcher Überlegungen kann allerdings sein, dass manche dabei zu dem Ergebnis kommen, dass ihr Plan B eigentlich gar nicht so schlecht ist – dass er im Gegenteil sogar viel zu gut ist, um seine Realisierung davon abhängig zu machen, ob man ihnen kündigt. Und die deshalb selbst zur Tat schreiten. Oder nur noch abwarten, ob sie vielleicht noch eine Abfindung mitnehmen können.
Pech für die betroffenen Unternehmen: Sie verlieren auf diese Weise nicht diejenigen, die sie gerne los wären, sondern diejenigen, die den meisten Mut, die besten Alternativen und den höchsten Marktwert besitzen. Gerade in Zeiten knapper werdenden Personals ist das ein Faktor, den Firmen bei ihrem Vorgehen nicht ungestraft ignorieren.
Mit Katastrophenfantasien umgehen
Es gibt jedoch auch Menschen, die zum «Katastrophisieren» neigen, wie es Albert Ellis, der Begründer der rational-emotiven Therapie, nennt. Sie malen sich ihr Schicksal in schwärzesten Farben aus und steigern sich immer tiefer in die Katastrophe hinein, bis sie schließlich voller Panik sind, ihre Kinder nicht mehr ernähren zu können und schließlich unter der Brücke zu enden. Ihnen können beherzte Vorgesetzte mit einem guten Gespräch sehr wohl Druck nehmen. Allerdings nur, wenn sie die Sorgen auch in ihrer Tiefendimension ernst nehmen und sie nicht mit vermeintlich beruhigendem Geschwätz wegzureden versuchen.
Beschwichtigungen à la «Machen Sie sich mal keine unnötigen Sorgen» oder «Ich weiß, du schaffst das» vermitteln den Adressaten nur das Gefühl, die Vorgesetzte sei entweder nicht gewillt oder nicht in der Lage, ihre Sorgen zu verstehen.
Wer Katastrophenfantasien ausräumen will, muss das Gegenteil des Üblichen tun und die Gefahr nicht verleugnen, sondern bestätigen: «Gleich wie unwahrscheinlich es ist: Ja, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Sie Ihren Job verlieren.» Keine Sorge: Das führt nicht dazu, dass die Adressaten nun endgültig durchdrehen – im Gegenteil: Sie fühlen sich zum ersten Mal verstanden und in ihren Ängsten ernstgenommen.
Das ist der Schlüssel: Nur wenn man den schlimmsten denkbaren Fall als reale Möglichkeit akzeptiert, kann man sich damit auch auseinandersetzen. Für diejenigen, die diese Gefahr, so gering sie auch sein mag, nicht verdrängen können oder wollen, ist die einzige sinnvolle Alternative, sich ihr zu stellen: «Ja, es könnte sein.» Dieses simple Statement ist – vermutlich mehr, als man beim Lesen merken kann – ein emotionaler Befreiungsschlag: Es ist das Ende des Verleugnens, Verdrängens, der sich selbst aufgezwungenen Blindheit.
Der zweite Schritt ist dann, diesen schlimmsten Fall in aller Konsequenz zu Ende zu denken. Einmal angenommen, den Betreffenden würde tatsächlich gekündigt (gleich wie unwahrscheinlich das ist), dann stünden sie ja nicht sofort auf der Straße: Sie bekämen eine Abfindung (mindestens ein halbes Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr, praktisch nicht selten ein ganzes), eventuell auch ein Outplacement, oder sie würden für
etliche Monate in einer Transfergesellschaft weiterbeschäftigt und bei der Suche nach einem neuen Job unterstützt.
«Was kommen wird oder könnte, quält die meisten Menschen mehr als die Widrigkeiten der Gegenwart.»
Am Ende eines ausführlichen, sorgfältig zu durchlaufenden Denkprozesses steht in aller Regel die Erkenntnis: Was im schlimmsten Fall wirklich droht, sind nicht hungernde Kinder und ein Nachtquartier unter der Brücke, aber im allerungünstigsten Fall, falls sie über etliche Jahre hinweg keine neue Stelle fänden, drohte sehr wohl ein empfindlicher Wohlstandsverlust. Der Absturz ins Bodenlose jedoch würde – wenigstens in
unserem vielgescholtenen Sozialstaat – durch Wohngeld, Bürgergeld, Kindergeld etc. verhindert.
Damit ist «der Boden gefunden»: Das ist tatsächlich der Worst Case: nicht irgendein mehr oder weniger willkürlich gewählter ungünstiger Verlauf, sondern der allerschlimmste denkbare Fall. Ihm gilt es ins Auge zu sehen, auch wenn er nur für den äußerst unwahrscheinlichen Fall droht, dass wirklich alles schiefläuft. Ist man gemeinsam bei dem konkreten Worst Case angekommen, kippt in aller Regel die Stimmung – und zwar nicht in Depression und Verzweiflung, sondern im Gegenteil in eine spürbare Entlastung und Entspannung. Warum? Eben weil aus den endlos kreisenden Katastrophenfantasien mit dem Absturz ins Bodenlose ein reales, greifbares Szenario geworden ist. Und in aller Regel ist das zwar alles andere als attraktiv und anstrebenswert, aber trotz allem kein Weltuntergang und auch keine Vernichtung der persönlichen Existenz.
In diesem deutlich gelasseneren Zustand kann dann der dritte Schritt angegangen werden, nämlich die Frage, was die Betreffenden selbst tun können, um der Sache einen positiven Verlauf zu geben: Was wären geeignete Strategien für den Umgang mit den gegenwärtigen Veränderungen, was weniger? Was wäre zweckmäßig zu tun oder zu unterlassen? Und auch hier: Was ist der Plan B für den Fall des Falles?
Schnellstmöglich für klare Verhältnisse sorgen
Aber was man auch tut: Ein Übergangszustand bleibt ein Übergangszustand – eine Zeit, in der alle teils bang, teils hoffnungsvoll darauf warten, dass er endlich vorbeigeht und wieder klare Verhältnisse einkehren.
Das Beste, was das Top-Management tun kann, um Stress von der Belegschaft zu nehmen und sie wieder zur Ruhe kommen zu lassen, ist dementsprechend, schnellstmöglich für klare Verhältnisse zu sorgen. Auch wenn den neuen Zustand, wie immer er aussieht, nicht alle mögen werden, sorgt er doch für ein Ende der Ungewissheit und die ersehnten klaren Verhältnisse.
Schnellstmöglich für Klarheit zu sorgen, liegt auch im wohlverstandenen eigenen Interesse des Top-Managements. Denn je länger der Schatten einer ungewissen Zukunft über dem Unternehmen liegt, desto mehr leidet unvermeidlich das Geschäft. Je länger diese Phase instabiler Leistungen andauert, desto größer das Risiko, dass es manchen Kunden und Kundinnen zu bunt wird und sie sich nach Alternativen umsehen. Wer aber erst einmal abgewandert ist, kommt nicht so leicht wieder zurück.
Ähnliches gilt für die Beschäftigten: Je länger man sie im Ungewissen lässt, desto mehr von ihnen beenden von sich aus das quälende Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins, indem sie erst ihr Herz und dann ihr berufliches Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Auch bei den Verbleibenden können bleibende Schaden entstehen, vor allem wenn sich das Gefühl breit macht, dass man sie unnötig lange schmoren ließ, um
sich irgendwelche zweifelhaften Vorteile damit zu verschaffen: «Die wussten doch schon lange …»
«Der Nutzen einfühlsamer Kommunikation ist begrenzt.»
Auf einen großen Vertrauensvorschuss sollte man dabei nicht bauen: Menschen, die Angst um ihre Zukunft haben, sind tendenziell misstrauisch gegenüber denjenigen, die die Entscheidungen treffen. Und sie sind anfällig für Gerüchte und Spekulationen – man hat manchmal den Eindruck: Je bizarrer, desto besser. Wer denkt, «Meine Leute kennen mich doch und wissen, dass sie mir vertrauen können», wird unter Umständen eine Enttäuschung erleben: Ein vertrauensvolles Verhältnis aus ruhigen Zeiten überträgt sich nicht ohne weiteres auf (subjektiv empfundene) Krisen. In Gefahr heißt es, sich in Acht zu nehmen.
Schwierige Entscheidungen beschleunigen
Das Problem beim schnellen Schaffen klarer Verhältnisse ist, dass «die da oben» oft sehr viel weniger Klarheit haben als die Ebenen unter ihnen unterstellen. Klar, man kennt die grobe Richtung – man weiß etwa, dass man von einer funktionalen Organisation auf eine Geschäftsfeldorganisation wechseln möchte oder dass man die übernommene Firma – vollständig? teilweise? – in die eigenen Strukturen integrieren will. Doch unterhalb dieser Grundsatzentscheidung sind jede Menge Einzelfragen offen und müssen mühsam Stück für Stück erarbeitet, diskutiert und entschieden werden.
Dafür sind drei Grundsätze hilfreich:
1. Wann man fertig wird, ist maßgeblich davon bestimmt, wann man anfängt. Wer zu spät kommt, weil «so viel Verkehr war», macht sich und anderen etwas vor. Es gibt eine hohe Korrelation zwischen dem Zeitpunkt, zu dem man aufbricht, und dem, zu dem man ankommt.
2. Wann man fertig wird, ist maßgeblich davon bestimmt, dass man in der heißen Phase zügig vorankommt – was wiederum an die banale technische Voraussetzung gekoppelt ist, dass genügend Zeit für Diskussionen im Vorstand oder der Geschäftsführung zu Verfügung steht.
3. Wann man fertig wird, ist maßgeblich davon bestimmt, dass man sich auf klare strategische Ziele und aus ihnen abgeleitete Entscheidungskriterien verständigt hat.
Voraus-Denken statt Hinterher-Denken
Ein klassischer Fehler bei Fusionen und Übernahmen ist, dass man viel zu spät damit beginnt, ernsthaft über die künftigen Strukturen und Abläufe sowie über den Integrationsprozess nachzudenken. Im schlimmsten Fall wird damit erst nach dem Closing begonnen, also nach dem rechtlichen Inkrafttreten der Verschmelzung. Das ist fatal, denn, wie Bahnreisende wissen, man kann noch so schnell fahren, eine stark verspätete Abfahrt macht man damit nicht wett.
Im Idealfall ist die Blaupause für die Integration am Tag des Closing fertig, und man kann am ersten Tag die künftige Organisationsstruktur samt der wichtigsten Stellenbesetzungen verkünden und sich sodann an die Detailarbeit machen.
Möglicherweise braucht man für einige Personalentscheidungen ein paar Wochen länger, weil man die mittleren Führungskräfte des übernommenen Unternehmens natürlich nicht alle kennt und etwas Zeit braucht, um sich ein Bild von ihnen zu machen. Allerdings dürfen sich diese verspäteten Besetzungen nicht zu lange verzögern, denn sonst hängen nicht nur die Betroffenen, sondern mit ihnen die gesamte Organisation unnötig um Wochen länger in der Luft als erforderlich.
Die Paradoxie dabei ist, dass es in der Regel wenig Grund zur Hektik gibt, sofern man nur rechtzeitig anfängt. Dann muss man gar nicht «so schnell wie möglich» fahren – es genügt, nicht zu trödeln und sich nicht zu verzetteln.
Genügend Top-Management-Zeit reservieren
Banale Planungsfehler bringen gerade Organisationsprojekte häufig in Nöte: Meist unterschätzt man dramatisch die Zeit, die das Top-Management braucht, um sich auf die vielen Einzelentscheidungen zu einigen. Oder man ahnt es zwar, wagt aber aus falschem Respekt nicht, darauf zu bestehen, dass entsprechend viel Zeit der hohen Herrschaften reserviert wird.
Und dann kommt es, wie es kommen muss: Plötzlich und überraschend braucht der Vorstand doch mehr Zeit, um alle nötigen Entscheidungen zu treffen. Doch am Tag darauf bricht der Vertriebsvorstand zu einer lange geplanten zweiwöchigen Chinareise auf, die er auf keinen Fall absagen kann. Nach seiner Rückkehr kriegt man mit Mühe und Not einen dreistündigen Termin in die Kalender gezwängt, an dem tatsächlich alle Vorstandsmitglieder gleichzeitig im gleichen Raum sein können, für den aber bereits diverse Stabsabteilungen andere Themen angemeldet haben. Die will man gleich am Anfang der Sitzung schnell abhaken – und am Ende bleibt von den drei Stunden noch eine knappe halbe für die Organisation, auch weil einige der Stabsleute es clever geschafft haben, dem Vorstand noch einige weder wichtige noch dringliche «Ach-übrigens-Themen» unterzujubeln. Dann müssen drei der Vorstände dringend los, um mit ihren Teams eine in der Folgewoche stattfindende Industriemesse in Barcelona vorzubereiten. Für die Vorstandsvorsitzende und den Finanzvorstand bindet derweil der bevorstehende Quartals-Analystinnen-Livestream den Großteil der Aufmerksamkeit. Das Resultat ist maximaler Stress bei weitgehendem Stillstand in der Sache. Denn natürlich wissen oder ahnen die Häuptlinge, dass ihre Indianer*innen ungeduldig auf Entscheidungen warten. Die Personalchefin hat schon mehrfach angemahnt, sie könne den Betriebsrat nicht mehr länger hinhalten; die Stimmung sei inzwischen sehr gereizt. Im mittleren Management, so berichtet sie, kursierten inzwischen Gerüchte, der Vorstand sei heillos zerstritten und nicht mehr einigungsfähig. Peinlicherweise ist der folgenschwere Patzer im Nachhinein so offenkundig und vorhersehbar: Dass der Vorstand mit den unzähligen Einzelentscheidungen in, sagen wir, sechs dreistündigen Sitzungen nicht fertigwerden würde, kann ex post jede Praktikantin «vorher»sagen.
Für Projektverantwortliche empfiehlt es sich daher, unerbittlich Zeit zu blockieren, einschließlich einiger Wochenenden, auch wenn das bei manchen Vorständen zu Missmut, hochgezogenen Augenbrauen oder offenem Protest führt. Doch sollte die reservierte Zeit wider Erwarten nicht benötigt werden, habe ich noch keinen Vorstand erlebt, der sich beschwert, er hätte nun plötzlich so viel Luft im Kalender und wisse nicht, was er in dieser Zeit machen solle.
Klare strategische Ziele
Zum Zeitfresser bei Vorstandsdiskussionen wird häufig, dass man sich in vielen Einzelfragen deshalb nicht einigen kann, weil man sich, ohne es bemerkt zu haben, in den Zielen uneins ist. Wenn die eine auf größtmögliche Autonomie der Sparten setzt und der andere auf die bestmögliche Nutzung der Synergien zwischen den Sparten, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie etwa bei der Diskussion über die Organisation des Controllings oder des Personalbereichs leicht einen Konsens finden.
Deshalb empfiehlt es sich, ganz zu Beginn, solange man noch nicht über die Bockbeinigkeit der Kolleg*innen verärgert ist, so viel Zeit wie erforderlich in die Klärung von Zielen und Kriterien zu investieren: An welchen nachprüfbaren Kriterien wollen wir denn festmachen, ob die Struktur eines Bereichs oder einer Abteilung optimal ist? Welche Ziele und Anforderungen sollten dann besser erfüllt sein als in alternativen Strukturen oder Modellen, welche Abläufe sollten dann besonders leichtgängig sein?
«Vor allem kommt es darauf an, Übergangsperioden möglichst kurz zu halten.»
Da wir Menschen aber nicht perfekt sind, wird es trotzdem passieren, dass man wichtige Aspekte übersieht. Deshalb ein weiterer «banaler» Tipp: Wenn Sie merken, dass Sie nun schon länger über einen Punkt debattieren, den Sie eigentlich rasch abzuhaken hofften, aber keinen Schritt vorankommen und langsam ärgerlich werden, dann treten Sie einen Schritt zurück und schlagen vor, die unausgesprochenen Ziele und Kriterien hinter den verschiedenen Vorschlägen ins Blickfeld zu nehmen: Welche stillschweigenden Anforderungen und Maßstäbe stehen hinter unseren unterschiedlichen Präferenzen? Worauf zahlt der eine Vorschlag ein, worauf der andere – und was sind wirklich die gemeinsamen Ziele und Prioritäten des Gremiums?
Wenn dabei unterschiedliche Anforderungen oder Prioritäten zutage treten, dann ist das ein großer Erfolg. Denn solange sie unerkannt sind, machen sie es schwer, voranzukommen und belasten das Klima. Aber es macht es notwendig, erst einmal auf der Zielebene für eine Klärung zu sorgen. Es gibt da keinen leichten Ausweg – oder genauer: Die Zielklärung ist der Ausweg. Solange man sich auf der Zielebene nicht einig ist, ist
eine Einigung in der Einzelfrage nur durch Machtausübung oder Erschöpfung möglich.
Resümee: Übergangszeiten sind belastend, weil Menschen von ihrer Fähigkeit, sich Sorgen um die Zukunft zu machen, meist überreichlich Gebrauch machen. Durch gute Kommunikation kann man sie etwas weniger belastend machen – oder zumindest nicht noch schlimmer. Vor allem aber kommt es darauf an, Übergangsperioden möglichst kurz zu halten. Das wiederum hängt nicht zuletzt an scheinbar banalen technischen Voraussetzungen wie dem frühzeitigen Vorausdenken und dem Einplanen von genügend Top-Management-Zeit.
Winfried Berner
(70) befindet sich derzeit selbst in einer Übergangssituation: Nach mehr als 25 Jahren Selbständigkeit übergibt er seine Firma und Website www.umsetzungsberatung.de an seinen langjährigen Kooperationspartner
initio Organisationsberatung und steht künftig nur noch in begrenztem Umfang als Speaker und (Very) Senior Change Coach zu Verfügung.
Literatur:
• Berner, W. (2022). Reorganisation und Restrukturierung – Strukturen verändern, ohne die Kultur zu ruinieren, Schäffer-Poeschel.
• Berner, W. (2017). Systemische Post-Merger-Integration, Schäffer-Poeschel.
• Doppler, K. & Voigt, B. (2012). Feel the Change! Wie erfolgreiche Change Manager Emotionen steuern, Campus.