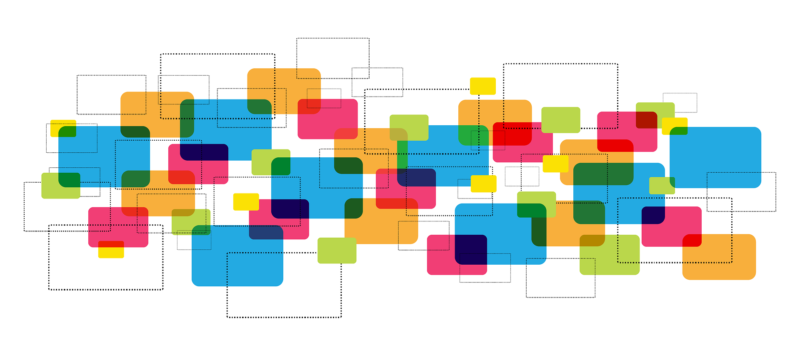„Die Seele denkt nie ohne Bild.“
Aristoteles
Rückblick: 10 Jahre Einblick
Rund 40 (interaktive) Schaubilder sind in den zehn Jahren, seit wir die Einblick-Rubrik in der ZOE 1/2007 das erste Mal publiziert haben, erschienen. Oft hatten die Bilder einen direkten Zusammenhang mit dem Schwerpunktthema eines Heftes, einige Male setzten sie bewusst Kontrapunkte. Neun Ausgaben waren dabei individuell nutzbar, sieben waren für Teams gedacht, und 24 haben organisationale (oder gar gesellschaftliche) Themen bzw. Herausforderungen abgebildet. Eine Change Management Thematik wurde dabei in etwas mehr als der Hälfte der Bilder behandelt. Das Thema Strategie haben wir in sechs Einblicken dargestellt. Das Themenspektrum reichte ansonsten von Ansätzen wie Nudging, über Herausforderungen wie Burn-out, bis hin zu Vorgehensweisen, etwa für Experimente oder für neue Ideen. Die meisten Einblicke hatten dabei die Form von visuellen Metaphern (es waren insgesamt 33 bildliche Übertragungen), je ein Bild war ein Comic, ein Kreuzworträtsel bzw. eine Weltkarte. Der kleine Rest waren Diagramme.
Philosophen, Literaten, Managementvordenker, Unternehmer, Politiker und Kreative: Die Zitate zu den 40 bisherigen Einblickbildern gingen durch alle Zeitalter, von Platon bis zu Bill Gates. Konkret gab es Zitate von Archilochos, Ashby, Brundtland, Camus, Churchill, Covey, Disney, Donne, Dostojewski, Drayton, Drucker (2x), Einstein, Emerson (2x), Gates, Goethe, Hemingway, Henry, James, Kant, Kay, Mintzberg, Kierkegaard, Laotse, Lewin, Lichtenberg, McLuhan, Minsky, Naisbitt, Platon, Schopenhauer, Seneca, Shaw, Simmel, Talmud, Tucholsky, Voltaire, Wittgenstein und da Vinci.
Jenseits dieser Zahlen, Themen und Namen, stellen wir uns natürlich vor allem diese Frage: Was macht ein gutes Einblickbild aus? Wir finden, es muss vor allem informativ und verständlich sein; das bedeutet, dass es relevante und wichtige Erkenntnisse in attraktiver, eingängiger Form darstellt. Darüber hinaus sollte es zum Nach- oder Weiterdenken anregen – nicht zuletzt durch die interaktive online Version und ihre Verweise. Wenn es ab und zu zum Schmunzeln anregt, so ist dies ein gewünschter Nebeneffekt. Einblickbilder, welche diese Kriterien besonders gut erfüllen, sind unseres Erachtens beispielsweise diese: das Gesprächslabyrinth (Gesprächssackgassen und ein Weg zueinander), der Stadtplan des Internets (informative Zusammenstellung wegweisender Sites und Gebiete), die Stationen der OrganisationsEntwicklung (eine interaktive Reise durch bisherige ZOE-Themen), das Feuerwerk an Theorien (eine bunte Mischung von Theorien mit Direktverlinkung ins ZOE-Archiv), die Beratungsfragen (eine Sequenz und Beispiele von weisen Fragen für Berater/innen), oder das Reich der Emotionen (eine kleine Typologie unserer Grundgefühle sowie Forscher dazu). Es lohnt sich, einen (zweiten) Blick auf diese und weitere Einblickbilder zu werfen; das hoffen wir zumindest.
Haben Sie einen eigenen Einblick-Favoriten? Sehen Sie das anders? Lassen Sie uns via leserfeedback@zoe-online.org gerne Ihr Feedback zur Rubrik wissen.