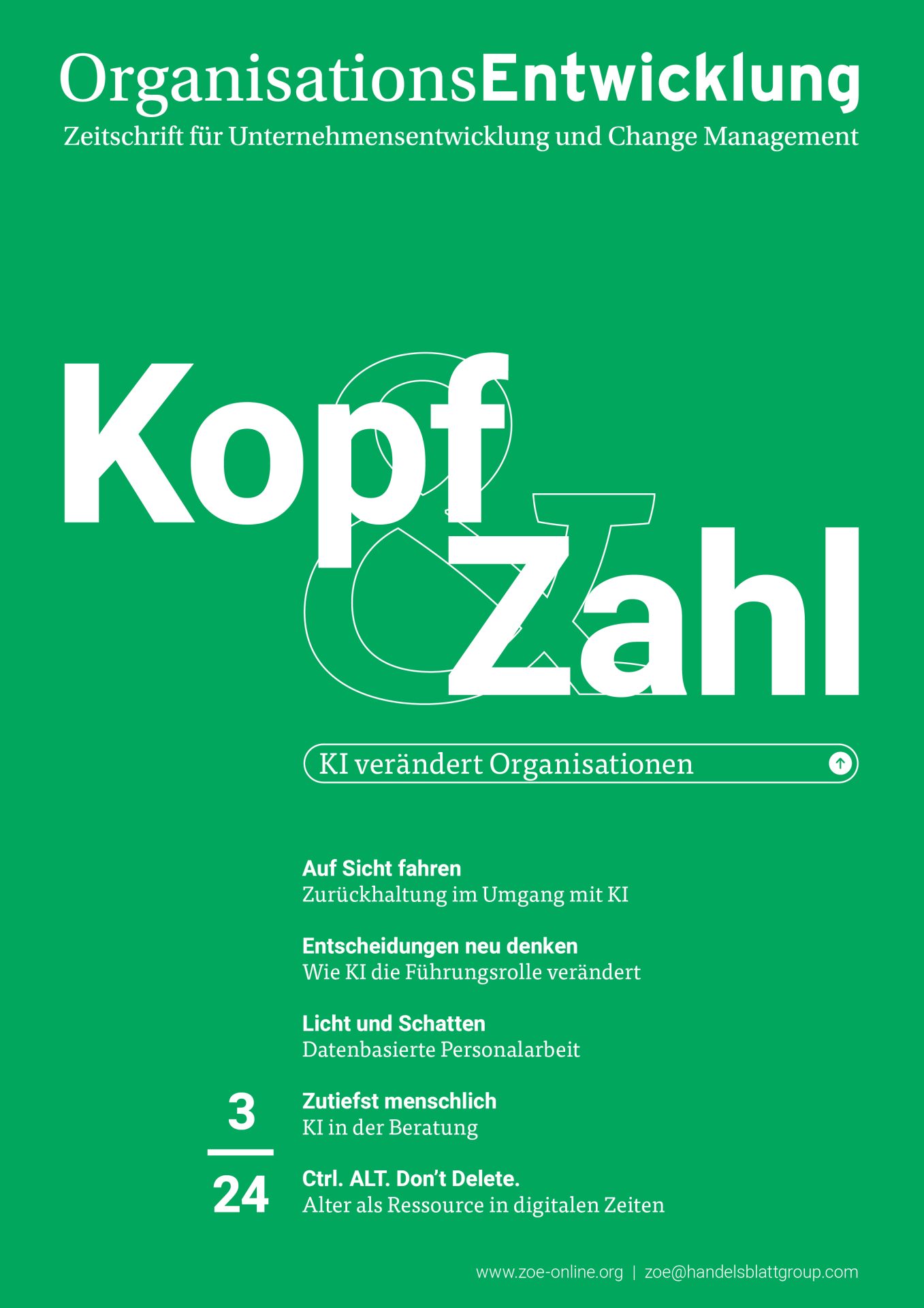ZOE: Steigen wir ganz grundlegend ein: Denke ich an Entscheidungen, denke ich an …
Quaquebeke: Als guter Wissenschaftler denke ich erst einmal an Definitionen. Und da ist es bei dem Wort Entscheidungen nicht einfach, denn Leute verstehen häufig zwei sehr unterschiedliche Dinge darunter: Auf der einen Seite gibt es Gleichungen, die optimal aufgelöst werden. Das heißt, auf der Basis von Diskussionen und Abwägungen von Daten weisen Risiko- und Chancenberechnungen auf eine bestimmte «Lösung» hin. Und das wäre dann auch das bessere Wort. Wir haben etwas gelöst und nicht entschieden.
Auf der anderen Seite stehen wirkliche Entscheidungen. Diese entstehen dann, wenn ich im Prinzip zwei oder mehr weitestgehend gleichwertige Optionen vor mir habe und diese nicht lösen kann, also kein probabilistisches oder wertegetriebenes Modell mir vorgibt, welche die bessere ist.
ZOE: Was ändert sich daran in Organisationen, wenn wir nun KI einsetzen?
Quaquebeke: KI kann uns bei ersterem helfen. Also beim Lösen. Denn letztendlich ist das die Stärke von KI: ein probabilistisches Abwägen aufgrund von Daten. Je nach programmiertem Alignment ist auch das Wertefundament klar. Die Schwierigkeit ist, dass KIs – derzeit zumindest noch – mit einem Selbstbewusstsein reden, dass wir meinen, dass sie etwas gelöst haben, obwohl es mit so viel Unschärfen versehen ist, dass es eigentlich eher eine Entscheidung war. Beispielsweise Lösung A wäre 49 Prozent und Lösung B 51 Prozent, aber bei kaum belastbarer Datenlage. Und trotzdem wird die KI es so vertreten, dass Lösung B eindeutig die bessere ist. Hier müssen wir in der Entwicklung nachsteuern, so dass beim Einsatz von KI auch erkenntlich wird, wie gut die dahinter liegende Datenlage und Wahrscheinlichkeitsabschätzung ist. Ansonsten nehmen wir das alles für bare Münze, obwohl es für viele Bereiche wahrscheinlich einstweilen noch klare menschliche «Entscheidungen» im Graubereich braucht.
Weiterlesen?
Für alle, die das Morgen schon heute denken.
* Testen Sie uns jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich –
mit Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel und Ausgaben.
Sie sind Abonnent, aber haben noch keinen kein Login? Hier registrieren mit Ihrem Abocode und vollen Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel erhalten.