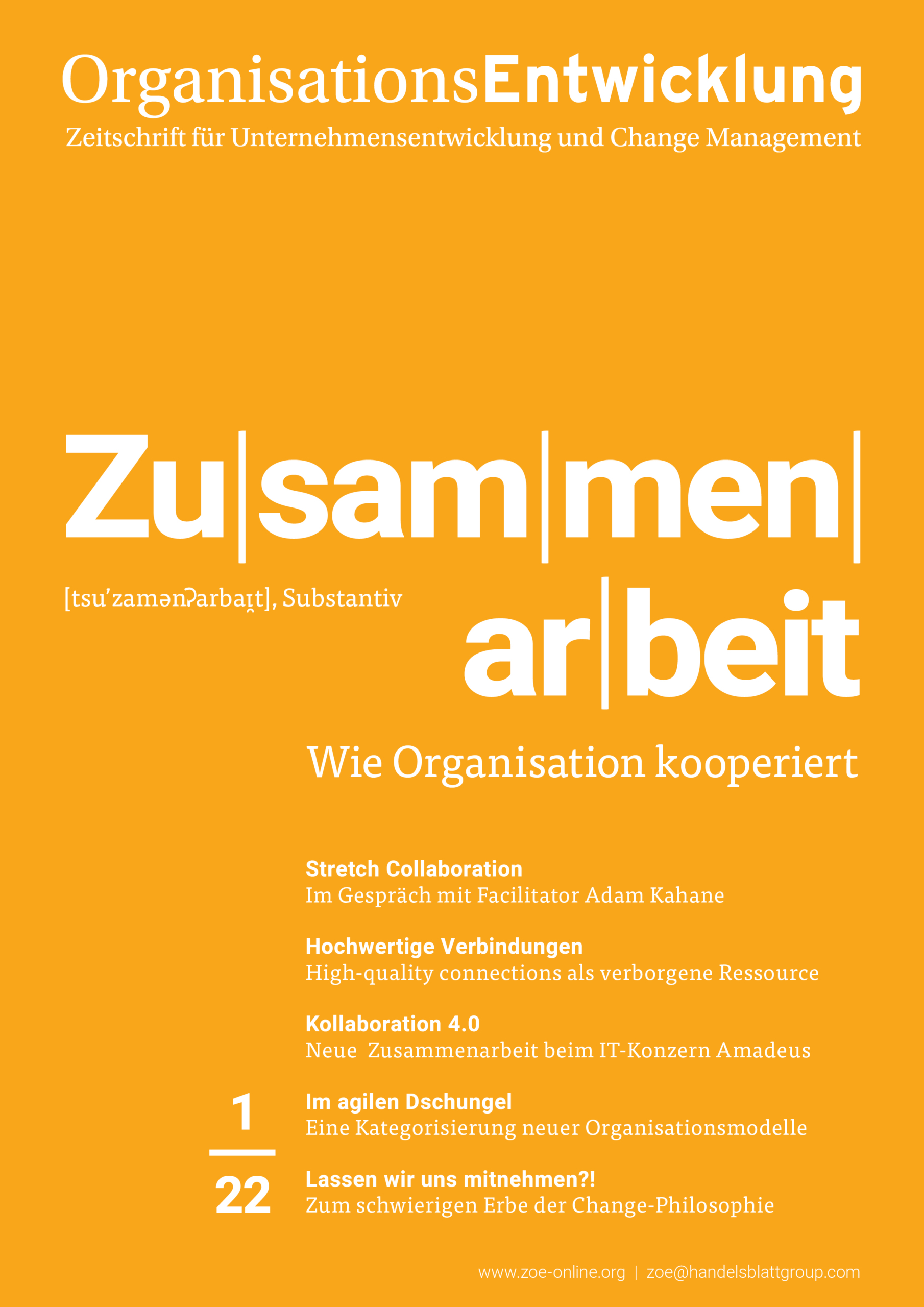Thomas Müller, Fußballer beim FC Bayern, erklärte den Champions-League-Erfolg seines Teams 2020 damit, dass «wir uns darum streiten, wer den Fehler des anderen wieder gut macht». Auch andere Organisationen wünschen sich diese kollektive Achtsamkeit und dieses Füreinandereinstehen, wenn es um gelingende Kooperation zwischen Geschäftseinheiten, Teams oder Personen geht. Die Organisationspraxis ist oft ernüchternder. Denn: Unser mentales Modell einer simplen Kooperation à la Bottle-Party («Jede*r bringt etwas mit und am Ende passt es schon») greift zu kurz. In nahezu allen Branchen ist der Komplexitätsgrad durch die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Sichtweisen und Narrative massiv gestiegen – Stichwort: Corona-Debatte.
Den Themenschwerpunkt haben wir mit viel Lust an der Zusammenarbeit zu zweit erarbeitet. Den Auftakt liefert Adam Kahane, der mit seinem Konzept der «stretch collaboration» aufzeigt, wie sich Zusammenarbeit in anspruchsvollen Konstellationen starker Ziel- und Interessenkonflikte gestalten lässt. Beatrix Busse beschreibt am Beispiel der Universität Köln, wie Expertenorganisationen durch ein «Arenenkonzept» Strategien und Kooperationsfähigkeit entwickeln. Monika Wiederhold und Barbara Perner berichten, wie durch eine neue Industriekollaboration innovative, digitale Lösungen für sicheres Reisen in der Covid-Krise entwickelt wurden. Bei all diesen Herausforderungen bilden nach Jane Dutton und Monica Worline «high-quality connections», d. h. besonders positiv erlebte zwischenmenschliche Begegnungen, eine wichtige, oft vernachlässigte Ressource für Kollaboration.
Außerhalb des Schwerpunkts erwartet Sie ein Blumenstrauß von Themen. In kritischer ZOE-Manier nimmt Maximilian Locher das «Mitnehmen» und «Abholen» im Wandel aufs Korn. Melissa Kowalski und Guido Möllering zeigen das Potenzial von Humor in Organisationen auf, gerade wenn es um Konflikte geht. Drei Beiträge zum Thema Agilität bieten Orientierung jenseits des Hypes: Herbert Gölzner und Julian Beyer ordnen die Vielfalt agiler Methoden. Sebastian Harrer, Lucie Perrot und Jasmin Drogi berichten über deren Weiterentwicklung bei der ING Deutschland. Sophie Hummel und Ann-Katrin Stehle zeigen anhand von neun Irrtümern, wie Unternehmen agile Methoden konterkarieren – und wie es funktionieren kann.
Kooperation ist und bleibt ein grundlegender Prozess für das Überleben und die Entwicklung sozialer Systeme. Mit den Worten von Henry Ford: «Zusammenkommen ist ein Anfang, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.»
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Herzlich, Ihr Thomas Schumacher mit Torsten Schmid