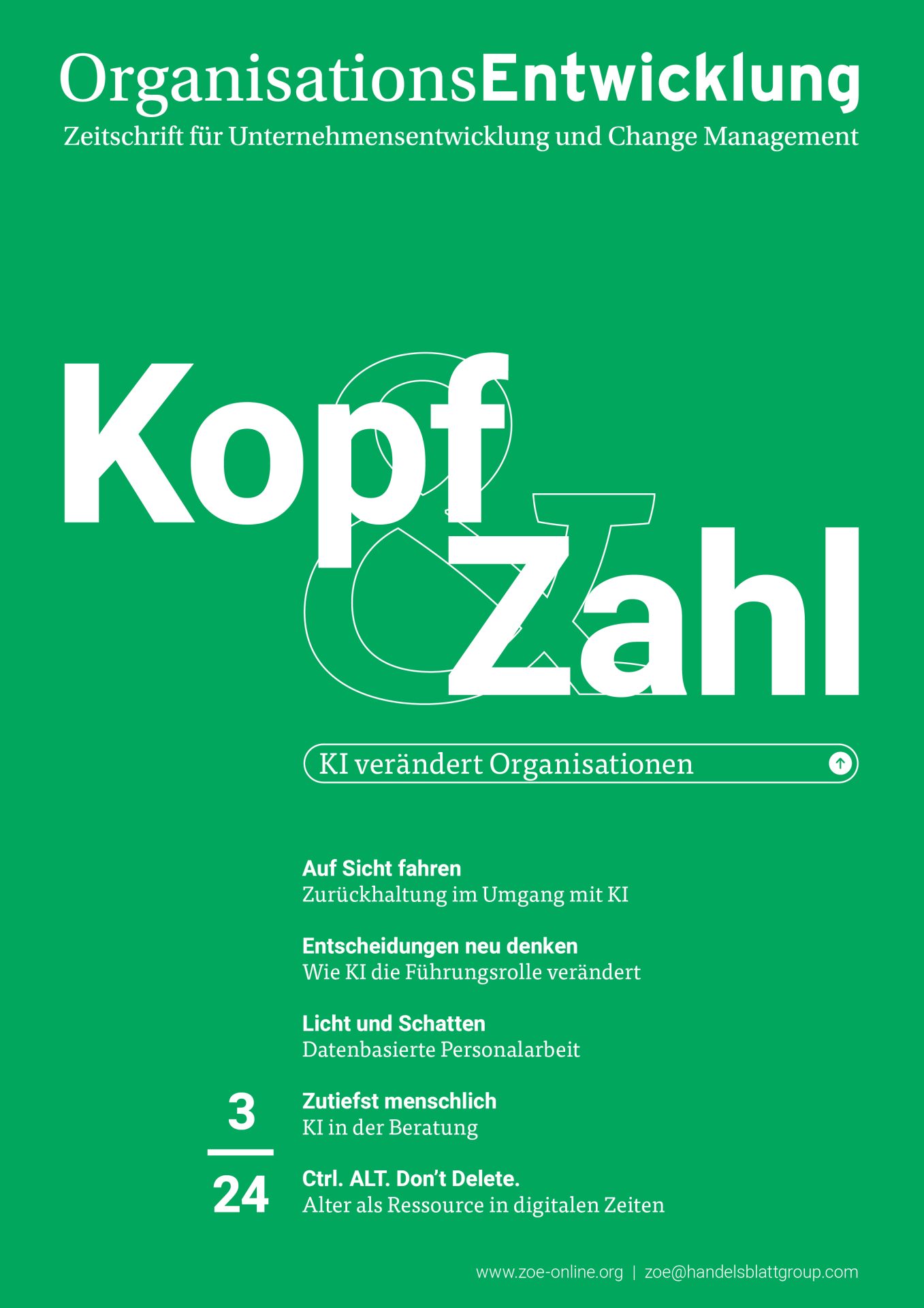ZOE: Sie sind ja seit der Veröffentlichung von ChatGPT am 30.11.2022 sehr viel zum Thema KI im Allgemeinen und ChatGPT im Besonderen befragt worden. Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus all den Diskussionen mit? Was bewegt die Leute?
Weßels: Das erste Jahr mit ChatGPT war mehr als turbulent. Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde, zumindest in den ersten Monaten, war, ob damit die Hausarbeit obsolet ist. Mit Hausarbeit meine ich schriftliche Ausarbeitungen von Schülern und Schülerinnen oder schriftliche Studienarbeiten von Studierenden. Der «Tatort» Schule war von Beginn an ein sehr großes Thema. Mich haben schon vor Weihnachten 2022 verzweifelte Anrufe erreicht von Schulleitern, -leiterinnen, Lehrern und Lehrerinnen, die völlig überfordert waren mit der Situation. Sie äußerten die Sorge, nicht mehr guten Gewissens bewerten zu können, was ihre Schüler mit in den Unterricht bringen, weil sie nicht wüssten, wie diese Hausarbeit erstellt wurde. Die Not und Überforderung aller Beteiligten war in jedem dieser Gespräche deutlich spürbar.
ZOE: Offensichtlich waren die Schüler und Schülerinnen quasi early adopter, die schnell den Nutzen von ChatGPT für sich erkannt haben?
Weßels: Der Einsatz von ChatGPT war und ist bis heute an vielen Stellen eine Bottom-Up-Bewegung in den Organisationen. Aus der Not heraus hat sich die Basis irgendwie gekümmert, man hat selber versucht sich fit zu machen und zu lernen damit umzugehen. Das bedeutet, dass eher die operative Basis, die unter Handlungsdruck stand, auch täglich mit dem Thema konfrontiert war, sich kümmern musste und ad hoc eigene Konzepte für Lösungen entwickelt hat. Eigentlich wäre es wünschenswert gewesen, dass die Führungsebene sehr viel schneller ihrem Führungsanspruch gerecht geworden wäre und dieses Thema strategischer geführt hätte. Aber da spürt man bis heute große Überforderung, Unkenntnis und mitunter auch tragische Missverständnisse dieser Technologie.
ZOE: Wie erklären Sie sich dieses Verhalten von Führungsseite?
Weßels: Neben der Überforderung spielt Angst eine große Rolle. Sie ist manchmal spürbar, manchmal sichtbar, manchmal kann man sie nur erahnen. Sie zeigt sich ganz konkret daran, dass man dieses Thema nicht anspricht und wenn es doch zu einem Thema wird, nicht einmal bereit ist etwas auszuprobieren.
ZOE: Was erzeugt diese Angst?
Weßels: Das fängt mit den Ressentiments gegen amerikanische Technologie an bzw. mit Datenschutzbedenken, dass man nicht wisse, was mit all den Inhalten passiere, die über KI generiert werden. Die Presse hat diese Perspektive zumindest in der Startphase von ChatGPT und Co. mit tendenziell eher kritischen und negativen Beiträgen über KI noch einmal verstärkt. Hier scheint das Phänomen der German Angst eindrucksvoll durch: Erstmal in aller Breite die Risiken diskutieren anstatt auch einen Blick auf die Chancen zu werfen. Das Ergebnis dieser Angst ist, dass viele Menschen sich nicht bei ChatGPT registriert und es ausprobiert haben. Verstärkt wurde dieser Effekt übrigens dadurch, dass man zunächst für die Registrierung seine mobile Rufnummer und bei der kostenpflichtigen Version seine Kreditkartennummer angeben musste. Das waren eigentlich keine großen Hürden, aber für viele Menschen in Deutschland anscheinend schon. Inzwischen wurden die Hürden für die Registrierung der kostenfreien Nutzung von ChatGPT auf Basis von GPT 3.5 gesenkt. Es bleibt abzuwarten, welche Effekte diese Form der Markterschließung des Anbieters OpenAI haben wird.
ZOE: Was kann gegen diese wohl eher grundsätzliche vorsichtige Zurückhaltung im Umgang mit KI getan werden?
Weßels: Wir müssen stärker die Ambivalenz erklären und betonen, dass die Medaille zwei Seiten hat. Neben den Risiken haben wir tolle neue Chancen, die es zu entdecken gilt. Daher sollten wir den Menschen Mut machen und sagen, registriere Dich einfach mal für einen Monat, probiere es aus, bilde Dir eine eigene Meinung und ein eigenes Gefühl von generativer KI. Fakt ist, dass wir eine solche Software in dieser Form noch nie zuvor erlebt haben. Auf der einen Seite spürt man die Faszination für die Möglichkeiten von KI, auf der anderen Seite bestehen sehr viele Sorgen und Bedenken, gerade im Hinblick auf die vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten. Im Kern sprengt diese Art von KI unsere Vorstellungskraft, denn diese Art von probabilistischen Algorithmen, verpackt in Software, ist uns fremd.
ZOE: Auch die Funktionalitäten von KI entwickeln sich ja kontinuierlich weiter. Macht es das nicht noch herausfordernder?
Weßels: Natürlich. Dass man zum Beispiel auch mit der Co-Pilot-App von Microsoft, kostenlos, auf allen mobilen Endgeräten in jeglicher Form kommunizieren kann, also auch sprachgesteuert. Man spricht rein, es wird einem wieder vorgelesen. Das ist schon beeindruckend und irritiert auch. Oder die Multimodalität, dass ich jetzt mit natürlicher Sprache sagen kann, ich hätte gerne Herrn Haas, blonder Mann, mittelalt, im Hintergrund schöne Bürolandschaft und zack, habe ich mit DALL-E 3 ein durchaus ansprechendes Bild. Und die Bildqualität wird jeden Tag besser. Auch das haben wir in der Form noch nicht erlebt. Oder dass man mit seinem Handy ein Foto von einem Möbelstück macht und sich dann erklären lässt, wie die Bauanleitung dieses Möbelstückes zu handhaben ist. Es ist sozusagen eine Tausendsassa-Funktionalität, im privaten wie im beruflichen Leben. Manchen Menschen macht das sehr viel Spaß, auf Entdeckungsreise zu gehen und eine solche Software auszuprobieren. Viele schrecken aber davor zurück.
ZOE: Wir erleben in vielen Organisationen schon heute eine Gruppenbildung in Digitale und Analoge. Verschärft KI diese Entwicklung noch mehr?
Weßels: Wir laufen durchaus Gefahr, dass wir die digitale Kluft in Organisationen und unserer Gesellschaft mit KI noch weiter verstärken. Auf der einen Seite haben wir dann diejenigen, die mit großer Experimentierfreude die neuen Technologien ausprobieren und nutzen, vielleicht auch gar nicht so reflektiert, was dann für Organisationen riskant werden kann. Auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die sich bis heute nicht mit technologischen Entwicklungen anfreunden, ja sogar damit kokettieren, keine Ahnung davon zu haben und in einen immer größeren Abstand zur ersten Gruppe der early adopter geraten. Diese Gruppe läuft Gefahr, gar nicht mehr auf diesen Zug aufspringen zu können, weil die Erfahrung fehlt. Wenn man selbst Erfahrungen im Umgang mit KI macht, lässt sich einfacher extrapolieren, denn man kann im Rückblick sagen: «Okay, noch vor drei Monaten gab es diese Funktion nicht oder ich habe mich an einer Funktionalität gestört. Jetzt gibt es diese Funktion und der Fehler ist behoben». Man begleitet quasi den Prozess der Softwarereife mit und trägt dieses Wissen und diese Erfahrungen mit sich. Diejenigen, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben, kommen sozusagen unvorbereitet dazu, müssen sich komplett neu orientieren und arrangieren und erleben dann zusätzlich quasi tägliche Änderungen. Das kann zu einer kompletten Überforderung führen, so dass der Versuch des Einstiegs gleich in den Ausstieg mündet. Mir geht es mit dieser unglaublichen Menge an KI-gestützten Werkzeugen, die sich rund um diese Technologie entwickeln, nicht anders. Auch ich verliere bisweilen den Überblick und weiß nicht mehr, welches Tool sich für welchen Zweck am besten eignet.
ZOE: Wir haben eine Datenschutz-Grundverordnung. Es gibt jetzt auf europäischer Ebene den AI Act – das ist weltweit einmalig. Man könnte salopp sagen: Regulieren können wir. Haben diese rechtlichen Rahmenbedingungen Auswirkungen auf das Nutzungs- und Anwendungsverhalten von Menschen? (Anm. der Red.: Siehe zum AI Act auch den Beitrag zu den rechtlichen Herausforderungen beim Einsatz von KI in Organisationen in dieser Ausgabe)
Weßels: Ich war bei der Anhörung eines Bundestagsausschusses zum EU AI Act im Juni 2023 dabei. Zu der Zeit war das ein ca. 140 Seiten umfangreiches Dokument mit komplexer Struktur und in dem damaligen Überarbeitungsmodus schwer zu lesen und zu verstehen. Hinter dieser Zielsetzung einer europäischen Regulierung von KI-Technologien verbirgt sich eine sehr schwierige Thematik, die sich bis zuletzt ja auch noch kontinuierlich verändert hat. Am 6.03.2024 wurde endlich die finale Version veröffentlicht, die in der deutschen Variante einen Umfang von 461 Seiten hat. Die Gefahr ist, dass der AI Act der schnellen technologischen Entwicklung von KI bei der Implementierung in den Mitgliedsländern hinterherhinken und damit veraltet sein könnte. Weil die Thematik für Bürgerinnen und Bürger so schwer zu vermitteln ist, bin ich unsicher, ob dieser Rechtsrahmen ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Selbst bei uns, die in dem Prozess aktiv beteiligt waren, ist diese Unsicherheit spürbar.
ZOE: Können Sie uns ein Beispiel geben, woran man die Schwierigkeit in der Vermittlung erkennen kann?
Weßels: Nehmen Sie den Begriff «Künstliche Intelligenz», damit fängt das Dilemma ja schon an, weil wir bis heute keine weltweit gültige und akzeptierte Begriffsdefinition haben. Was ist eine KI und was ist nicht KI? Es drohte zwischendurch sogar die Gefahr, dass alles Mögliche an Software quasi wie KI gehandhabt werden sollte. Von besonderer Relevanz ist der Umgang mit den großen KI-Sprachmodellen, die als Basismodel
oder Foundation Model bezeichnet werden. Werden bei Open Source-Modellen ganz andere Regeln angewandt als bei Closed Source-Modellen? Ist das eine kluge Abwägung? Und Open Source ist auch nicht gleich Open Source, zumal sich auch da manchmal große Konzerne dahinter verbergen. Auch bei dieser Software-Kategorie müsste man also wieder genau hinschauen. Ich denke schon, dass die Stoßrichtung des EU AI Acts
richtig ist, aber ich bin mir unsicher, ob wir eine gute Balance gefunden haben oder zukünftig finden werden in der Umsetzung von Maßnahmen zur Regulierung und Förderung von Innovationen und Technologienutzung.
ZOE: Lassen Sie uns auf Organisationen schauen. Was muss auf organisationaler Ebene passieren, um die Potenziale von KI zu nutzen?
Weßels: Deutschen Organisationen wird ja mitunter unterstellt, dass sie in der Digitalisierung eher zögerlich und vorsichtig agieren, um nicht zu sagen, in manchen Bereichen bereits abgehängt sind. Das spüren wir auch beim Einsatz der Zukunftstechnologie KI. Das heißt, wir sind von unserem digitalen Mindset her eher zögerlich und risikoavers. Und gerade diese in den Führungsebenen festzustellenden Vorbehalte bremsen uns auf organisationaler Ebene aus. Zwar wird gerne die «neue» Fehlerkultur als Kennzeichen einer modernen Organisationskultur betont, aber in der Realität möchten vor allem Führungskräfte keine Fehler machen, was sich wiederum auf die Gesamtorganisation auswirkt.
ZOE: Was möchten Sie also Führungskräften in Sachen KI zurufen?
Weßels: Experimentiert! Das bedeutet auch, eine Fehlerkultur zu leben und nicht nur zu proklamieren. Das Risiko einzugehen, Fehler zu begehen, liegt in der Natur der Sache und verschafft in erster Linie Erkenntnisgewinne. Es ist daher positiv zu sehen. Leider erlebe ich sehr selten Führungskräfte, die wirklich experimentierfreudig und mutig sind, die etwas wagen und auch bereit sind, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Stattdessen fährt man auf Sicht und sucht die vermeintliche Sicherheit. Für mich bedeutet das letztendlich auch mangelnde Übernahme von Verantwortung. Und deshalb bewegt sich in Deutschland vor allem in der öffentlichen Verwaltung sehr wenig. Wenn ich mir das so anschaue, wirkt es auf mich sehr beunruhigend. Da wird eher noch eine neue Regel, ein neuer Prozess aufgesetzt und noch weiter bürokratisiert, als dass etwas verschlankt wird.
«Wir sind von unserem digitalen Mindset her eher zögerlich und risikoavers.»
ZOE: Gilt das auch für Unternehmen?
Weßels: Glücklicherweise zeigen sich in der Wirtschaft viele Unternehmen deutlich aufgeschlossener. Ich durfte im letzten Jahr sogar mehrfach Unternehmenslenker*innen kennenlernen, für die es selbstverständlich war, dass KI eine Zukunftstechnologie ist. Die Köpfe dieser Organisationen waren eher ungeduldig, was den schnellen Einsatz der KI-Tools anging, weil sie die Sorge hatten, ansonsten von ihren Wettbewerbern abgehängt zu werden. Ich würde mir wünschen, dass wir in unserer öffentlichen Verwaltung und im politischen Umfeld eine Haltung entwickeln, die stärker unternehmerisch geprägt ist, dann wären wir viel weiter. Ich vermute aber, dass, selbst wenn Einzelpersonen die Dinge etwas dynamischer voranbringen wollen, ihr Umfeld sie noch ausbremsen könnte.
ZOE: Unternehmen erleben ja bekanntlich eine radikal andere Überlebensnotwendigkeit als eher auf Stabilität ausgerichtete Verwaltungsorganisationen. In welchen Branchen erleben Sie in Deutschland, trotz aller Beharrungskräfte, tatsächlich schon eine selbstverständliche Nutzung von KI im Tagesgeschäft?
Weßels: In Unternehmungsberatungsgesellschaften, denn dort ist es naheliegend, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen, beziehungsweise sie intensiv zu nutzen. Die Erstellung von Gutachten oder Stellungnahmen, der Entwurf eines Konzepts, das Design von Maßnahmen, … – hier wird KI sehr stark genutzt. Dass das nicht unbedingt nach außen getragen wird, liegt in der Natur der Sache. Das verändert natürlich auch dort die Geschäftsmodelle und -praxis. Als Kunde oder Kundin frage ich mich, ob ich noch bereit bin, hohe Tagessätze für eine automatisierte Dienstleistungen zu bezahlen, die ich vielleicht mit den richtigen KI-Tools sogar selber in der Lage bin zu generieren. Überall dort, wo der wirtschaftliche Druck sehr groß ist, wo der Wettbewerb sehr groß ist, wo der Druck zu automatisieren schon früher sehr groß war, da wird man an dieser Technologie nicht vorbeikommen.
ZOE: Wie ist es diesen Organisationen gelungen, KI einzuführen, zu nutzen und dabei die von Ihnen angesprochene Angst zu beseitigen?
Weßels: Nehmen wir das Unternehmen Otto in Hamburg. Dort wurden ganz bewusst Frei- und Experimentierräume geschaffen, die das Management gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nutzen kann, um die kreative Kraft und Energie, die in einer solchen Organisation stecken, zusammenzuführen und ihnen den Raum zur Entfaltung zu geben. Das finde ich großartig. Das habe ich bei uns zum Beispiel im Hochschulumfeld im letzten Jahr noch nicht erlebt, dass eingeladen wurde, zu einen Lab Day oder einer Veranstaltung, wo wir zusammenkommen und vielleicht mal Lern-Bots prompten oder ähnliches. Das wären aus meiner Sicht relativ naheliegende Dinge, die man sofort umsetzen könnte.
«Wenn Unternehmen sich kollektiv, offen und angstfrei auf KI einlassen, sind Erkenntnisgewinne vorprogrammiert.»
In einem Projekt, welches ich mit Fördermitteln des Landes Schleswig-Holstein umsetze, geht es darum, diese KI-Technologie zu nutzen, um als Booster für Gründungsvorhaben zu dienen. Dabei schauen wir vor allem auf die frühen Phasen im Gründungsprozess: Ich brauche einen Slogan, ich brauche ein Logo, ich brauche Marketing-Texte usw.. Dabei setzen wir KI-Werkzeuge ein und schauen, wie katalytisch sie im Gründungsprozess wirken können. In diesem Projekt haben wir beispielsweise sogenannte «Promptathons» schon mehrfach durchgeführt. Der Begriff lehnt sich an den Begriff Hackathon an, bei dem intensiv programmiert wird. Beim Promptathon geht es um die die besten Benutzereingaben (=«Prompts») für die KI-Systeme. Dabei trifft man sich in einem etwas spielerisch anmutenden Format, und es wird eine Aufgabenstellung gegeben. Man gründet quasi fiktiv. Und wir versuchen diesen Gründungsprozess von vorne bis hinten maximal durchzuprompten. Das heißt, KI-Technologie mit all diesen Tools und Werkzeugen einfach zu gestalten und diesen Prozess durchzuspielen. Ähnliches in einem vergleichbaren Format würde ich mir auch in Organisationen wünschen. Das gemeinsame Miteinander verbindet und reduziert viele Ängste. Man lernt sehr schnell und viel voneinander. Es hat mich das ganze letzte Jahr sehr gewundert, dass im Bereich Wissensmanagement der Einsatz von KI-Tools mit seinen Potenzialen nicht viel intensiver diskutiert wurde. An solchen Formaten wie einem Promptathon kann man schon erkennen: Wenn Unternehmen sich kollektiv, offen und angstfrei auf KI einlassen würden, wären Erkenntnisgewinne für den zielstiftenden Einsatz im Unternehmen vorprogrammiert.
ZOE: Das klingt nachvollziehbar, setzt aber voraus, dass man sich jenseits von Status, Seniorität und Einfluss auf ein Ko-Experimentieren einlässt, wo man selber die lernende Person ist. Kurzum: Es braucht ein anderes organisationales Miteinander. Wie kann das gelingen?
Weßels: Meine Studierenden würden darauf vermutlich antworten, dass dieses Miteinander im Kern eine agile Organisation ist, so wie sie sein sollte. Dabei wollen auch Mitarbeitende gehört werden, sich mit Expertise und Verantwortung einbringen und nicht irgendwelche Entscheidungsvorlagen formulieren, die monatelang über Hierarchieebenen abgestimmt werden, nur um nach Wochen des Wartens eine Entscheidung zu erhalten, die dann schon wieder veraltet ist. Gerade jüngere Expertinnen und Experten erwarten eine agile Organisationsform, die ihrem Namen auch gerecht wird. Das heißt, ein Miteinander auf Augenhöhe, wo man seine Ideen einbringen kann, aber auch Feedback bekommt. Das ist der jungen Generation sehr wichtig. Sie will mitgestalten und zwar im Dialog mit den Vorgesetzten. Von daher ist das für mich keine neue Organisationsform. Aber wir spüren natürlich, dass die Organisationen, die nicht so aufgestellt sind, mit dieser Dynamik und der rasanten technologischen Entwicklung überfordert sind. Man muss sehr
schnell reagieren und sollte im Idealfall sogar antizipieren können. Wer nicht so aufgestellt ist, kann die Potenziale von KI unter Umständen nicht schnell genug erschließen.
ZOE: Meine These ist, dass viele Organisationen sehr gut im Optimieren sind, das heißt, die Dinge etwas richtiger zu machen. Ist eine optimierende Veränderungslogik für KI angemessen?
Weßels: (lacht) Ja, ich muss schmunzeln, denn das, was Sie beschreiben, ist ja das Innovator’s Dilemma von Christensen. Das heißt, man ist in seinem Business gut und erfolgreich und versucht das kontinuierlich zu optimieren. Darin sind wir alle sehr gut, das hat auch mein Studium ganz stark geprägt, Geschäftsprozess-Management und Geschäftsprozess-Optimierung, hier noch ein Rädchen drehen und da noch ein bisschen besser und toller. Aber das ist eben ein Dilemma. Und das führt dazu, dass wir nicht rechtzeitig völlig neue Wege identifizieren. Das heißt, der Blick ist zu stark auf das Hier und Jetzt gerichtet und wir können
gar nicht so schnell in eine völlig andere Welt springen. Das ist der Klassiker, Airbnb tritt an, hat ein Geschäftsmodell, was darauf basiert, dass man gar kein Hotel und gar keine Wohnflächen hat, sondern einfach nur das Ganze vermietet, beziehungsweise vermakelt. Oder Uber, der andere Klassiker. In ähnlicher Art und Weise widerfährt uns das jetzt. Das heißt, wir müssen uns rauskatapultieren aus unserer alten Gedankenwelt, aus unserem alten Business und Themen völlig neu denken. Ich erlebe das im Bildungsbereich besonders intensiv. Wir können uns aus unserem Hier und Jetzt auch als Gemeinschaft in einer Organisation nur ganz schwer rausbeamen und uns dann ein gemeinsames Szenario vorstellen und hierfür ein gemeinsames Zielbild entwickeln, wie wir uns unter diesen stark veränderten Rahmenbedingungen für die Zukunft neu aufstellen müssten und könnten. Es ist aufwändig, weil nicht nur die Rahmenbedingungen volatil sind, sondern auch der Erfolg der Vergangenheit einem Denken in alternativen Zukünften im Weg steht.
ZOE: Die Aufgabe von Führungssystemen ist ja mitunter gerade, dieses Dilemma aktiv zu bespielen, also der Organisation nicht nur das zu geben, was sie täglich verlangt, sondern auch das, was sie zukunftsfähig macht. Wie soll das aber bezogen auf KI gehen, wenn das Wissen über diese Technologien bei Führungskräften vergleichsweise gering ist?
Weßels: Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das ansprechen. Führungskräfte sind bei KI überfordert. Aber sie schämen sich, nach außen zu gehen, vor die Belegschaft zu treten und zu sagen: «Tut mir leid, aber ich verstehe es auch nicht, ich habe das nie gelernt, und ich traue mich da auch nicht ran.» Viele können das mit ihrer Rolle der (übergreifend) fachlich kompetenten Führungskraft nicht vereinbaren. Das heißt, das Thema der betrieblichen Weiterbildung müssen wir zukünftig ganz, ganz anders leben. Es muss absolut normal sein, dass man kontinuierlich dazu lernt. Und zwar in einem Tempo, was wir zuvor noch nie erlebt haben. Ich muss jetzt meines Jobs wegen selbst notgedrungen sehr viel schneller ständig Neues lernen als früher. Auch ich erlebe immer wieder Momente der Überforderung und habe das Gefühl, ich komme gar nicht mehr hinterher, obwohl ich das eigentlich jeden Tag praktiziere. Von daher habe ich vollstes Verständnis dafür, dass so viele Menschen diese rasante technologische Entwicklungsgeschwindigkeit als bedrohlich empfinden. Aber es hilft nun mal nichts, wir müssen versuchen, mit diesem Tempo Schritt zu halten – so gut es geht. Das heißt, wir müssen Weiterbildung in den Organisationen auf allen Ebenen als etwas sehr Selbstverständliches und ganz Natürliches darbieten. Im Schulbereich ist die Integration dieser kontinuierlichen Weiterbildungen sehr schwierig. Lehrer und Lehrerinnen müssen in technologischen Entwicklungen in immer kürzeren Zyklen kontinuierlich weitergebildet werden. Argumentiert wird hingegen oft, dass man schon jetzt total überfordert sei und man keine Zeit für Seminare oder Trainings habe. Bei uns im Hochschulbereich ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Weiterbildungsangeboten für Lehrende noch weniger entwickelt. Hochschullehrenden wird vielfach unterstellt, dass sie sich autodidaktisch weiterbilden. Das kann man in bestimmten Bereichen sicherlich, aber nicht in der Breite der ganzen Themen, die uns hier beschert werden.
ZOE: Was bedeutet das also ganz konkret für Weiterbildung und Personalentwicklung?
Weßels: Weiterbildungen und Personalentwicklungsmaßnahmen, die wir bisher freiwillig und vielleicht einmal im Jahr gemacht haben, sind nicht mehr ausreichend, um mit der Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen mitzuhalten. Das kontinuierliche und lebenslange Lernen muss in allen Organisationen zu einem Top-Thema werden und höchste Priorität genießen. Eigentlich geht diese Priorisierung sogar über die Organisationsgrenzen hinaus: Es muss uns gelingen, uns wirklich zu einer lernenden Gesellschaft zu entwickeln, die Lernen als etwas ganz Selbstverständliches ansieht und nicht als Belastung. Das umfasst die Einstellung zum Lernen, dass dies etwas Bereicherndes ist, was uns persönlich, beruflich und als Gesellschaft voranbringt. Wenn uns das gelingen würde, diesen Funken zu zünden, dann hätten wir aus meiner Sicht den gordischen Knoten an einer ganz entscheidenden Stelle durchschlagen.
ZOE: Hätten Sie auch konkrete Ideen oder Lösungsansätze, wie es gelingen könnte, organisationales Lernen zu KI stärker als notwendige Daueraufgabe zu positionieren?
Weßels: Ein wichtiger Lösungsbaustein besteht darin, den persönlichen Nutzen des Lernens aufzuzeigen. Wenn man Menschen vermitteln kann, dass sie durch KI vielleicht 20 Prozent ihrer ungeliebten Routinetätigkeiten einsparen können, sie damit entlastet werden und sich endlich anderen Aufgaben zuwenden können, die viel mehr Spaß machen und wo sie sich als Mensch mit all ihren Fähigkeiten einbringen können, wirkt das sehr motivierend. Dann steigen Menschen in das Thema ein und spüren den Nutzen. Und das kann bei dieser Technologie an vielen Stellen gelingen, weil sie ja in der Lage ist, uns an so vielen Punkten von Routinetätigkeiten zu entlasten. Aber das muss verständlich kommuniziert werden, so dass die Menschen das akzeptieren. Dann ist die Bereitschaft zum Mitmachen auch da. Wenn man aber einfach zu einer Weiterbildung geschickt wird, die als Zwang und Belastung empfunden wird, ist diese Motivation einfach nicht in dem Maße gegeben, wie es wünschenswert wäre. Das spiegelt sich dann in der Regel im Ergebnis wider.
«Wir müssen uns rauskatapultieren aus unserer alten Gedankenwelt und Themen völlig neu denken.»
ZOE: Wir schauen ein Stück in die Zukunft und befinden uns im Jahr 2025: Wo stehen wir in Sachen KI und was sollten Organisationen mit Blick auf die nächsten Monate jetzt angehen?
Weßels: Was in technologischer Hinsicht klar ist: Es kommen neue Endgeräte. Alleine der Blick auf diese Geräte wirft schon so viele Fragen auf, da damit ganz neue Anwendungsszenarien entstehen, sehr gut sichtbar am Beispiel Humane AI.
ZOE: Was ist das?
Weßels: Das ist eine Alternative zum Smartphone in Form einer Brosche, die man sich anheften kann. Mit diesem Sticker kann man telefonieren, reden und er antwortet auch, weil er einen Lautsprecher hat. Ich kann mir das, was dann dort produziert wird, zusätzlich über einen integrierten Projektor in die Handflächen projizieren lassen. Endgeräte wie diese werden viele Veränderungen und ganz sicher auch Fragen aufwerfen: Wie werden wir das benutzen? Wo darf man das benutzen? Ein solches Endgerät kann ein Game Changer sein.
ZOE: Was wird noch auf uns zukommen?
Weßels: Augmented Reality und Mixed Reality werden sich ebenfalls weiterentwickeln. Apple hat mit seiner Datenbrille Apple Vision Pro ein solches Mixed-Reality-Headset schon im Februar auf den Markt gebracht, was ebenfalls völlig neue Szenarien für die Nutzung virtueller Welten bietet. Dann wird die Multimodalität weiter voranschreiten. Das heißt, wir werden mit einem Klick zwischen Text, Bildern, Audiodateien, Videos und 3D-Welten hin- und herwechseln können. Heute dominieren die Transfers Text-to-Speech, Text-to-Image, Text-to-Audio und zurück. Zukünftig werden wir mit Leichtigkeit komplette Videos generieren können, vielleicht sogar ganze Spielfilme.
«Entwicklungen dieser Art werden gesellschaftliche Auswirkungen haben.»
ZOE: Jetzt haben Sie mich verloren. Wir werden unsere eigenen Spielfilme generieren können?
Weßels: Ich setze mich vor irgendein Gerät und möchte mir einen Film anschauen mit dem Superhelden, den ich so gerne sehe, aber mit einer ganz besonderen Stimme. Außerdem sollen noch diese und jene Schauspielerinnen und Schauspieler in dem Film erscheinen und am liebsten mit folgender Story. Kurzum: Wir werden uns Spielfilme individualisiert und «on demand» generieren lassen können, so meine Prognose.
ZOE: Das stelle ich mir zugegeben gruselig vor. Werden wir durch solche individualisierten Applikationen nicht zunehmend einsamer?
Weßels: Ganz sicher werden Entwicklungen dieser Art gesellschaftliche Auswirkungen haben. Vereinsamung und Vereinzelung, aber auch zunehmende gesellschaftliche Zersplitterung halte ich für eine sehr große Gefahr. Früher hat die Familie gemeinsam vor dem Fernseher gesessen und eine Abendsendung oder eine Abendshow geschaut. Dieses familiäre Miteinander wird leiden. Das ist eine große Sorge, die ich habe. Übrigens zu Beginn des letzten Jahres gab es bereits Entwicklungen, die schon in diese Richtung gingen. So wurde behauptet, dass durch ChatGPT das gemeinsame Lernen von Eltern mit Kindern am Nachmittag
oder vor dem Abendessen entfallen würde, weil die Kinder ja sehr erfolgreich alle Hausarbeiten vermeintlich eigenständig gelöst haben. Und dadurch würde die Kommunikation in der Familie leiden. Da ist sicherlich was dran.
ZOE: Das setzt natürlich voraus, dass Menschen überhaupt Zugang zu Technologien haben, die sie dann einsetzen können. Es ist kein Geheimnis, dass nicht alle gleichermaßen von den Potenzialen technologischer Entwicklungen profitieren, Stichwort digital divide.
Weßels: Ja, technologische Entwicklungen trennen uns in der Tat in gesellschaftliche Gruppen. Wir haben immer mehr digital Abgehängte. Das erleben wir in allen gesellschaftlichen Gruppen. Es zerreißt uns quasi immer mehr und polarisiert auch. Daher werden diese Diskussionen um die gesellschaftlichen Auswirkungen von Technologie auch sehr emotional geführt. Es fehlt uns ein gemeinsames gesellschaftliches Verständnis hierzu, ein Collective Mind. In Organisationen ist es Führungsaufgabe, die Belegschaft zusammenzuhalten und zielorientiert zu führen, diese Diskussionsprozesse zu leiten und ein wechselseitiges Verständnis und ein gemeinsames Vorgehen in der Organisation abzustimmen. Eines steht aber außer Frage: Die Kommerzialisierung technologischer Entwicklungen wie beispielsweise KI wird weitergehen. Die Unternehmen, die ihre Experimentierphase durchlaufen haben, kommen nun in die Anwendungs- und Umsetzungsphase. Und genauso wie wir es gesellschaftlich erleben, wird es auch Organisationen geben, die KI erfolgreich für sich zu
verstehen nutzen und andere, die komplett abgehängt sind.
ZOE: Wir haben zu Beginn über Ängste und Sorgen gesprochen. Eine ist, dass KI den Menschen überflüssig macht. Können Sie uns zum Abschluss des Gesprächs von dieser Angst befreien?
Weßels: Die Diskussion über die Grenze zwischen Mensch und Maschine ist in der Tat ein großes Thema. Wir merken, die Maschine, die KI, kann immer mehr, und sie dringt nun in Bereiche vor, die wir eigentlich als unsere menschliche Stärke und als unser Wesensmerkmal bewertet haben. Über viele Jahre haben wir es uns nicht vorstellen können, dass Technologien in diese Bereiche vordringen können. Nehmen wir das Beispiel Kreativität: Da habe ich auch vor zwei Jahren noch die Meinung vertreten, dass der Mensch in Sachen Kreativität gegenüber der Maschine überlegen ist und dass KI uns hier nicht «gefährlich» werden kann. Heute wissen wir, dass das eben nicht der Fall ist. Da mussten wir unseren Jägerzaun als Schutzzone für unsere Domäne schon ein wenig öffnen. Was zeichnet uns denn als Mensch aus? Ich denke, dass wir uns unsere menschlichen Stärken viel stärker bewusst machen müssen, um sie dann auch viel stärker zu nutzen. Wir Menschen verfügen zum Beispiel über die Fähigkeit der Intuition. Dieses Bauchgefühl ist das Ergebnis unseres Menschwerdungsprozesses, unserer Sozialisation. Wir tragen sehr viel stilles Wissen in uns, ohne dass wir sagen können, wie und warum wir etwas können. Das sind alles unsere menschlichen Stärken, die wir in
deutlich größerem Umfang einsetzen müssen. Ich zumindest habe mir vorgenommen, meiner Intuition viel mehr Raum zu geben als ich das zuvor gemacht habe.
Das Gespräch basiert auf dem Stand der Entwicklungen zu KI am 25.4.2024.
Prof. Dr. Doris Weßels
Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel, Mitgründerin und Mitglied im Leitungsteam des Virtuellen Kompetenzzentrums «Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten – Tools und Techniken für Bildung und Wissenschaft»
Oliver Haas
ZOE-Redakteur, Seniorberater der osb international
Glossar
• Foundation Model: Foundation Models sind KI-Computermodelle, die durch Methoden des maschinellen Lernens auf einer großen Datenmenge trainiert wurden und als Basismodelle für unterschiedlichste Anwendungen angepasst werden können.
• Prompting: Ein Prompt ist eine Anweisung oder eine Eingabe, die an ein KI-System gerichtet wird, um eine bestimmte Antwort oder Aktion zu initiieren. Prompts können Texte, visuelle Signale oder Audio-Anweisungen sein und sind ein integraler Bestandteil der KI-Interaktion.
• Augmented Reality und Mixed Reality: Augmented Reality ist eine Technologie, die digitale Informationen in die reale Welt integriert. AR-Erlebnisse können durch Geräte wie Smartphones oder AR-Brillen ermöglicht werden, wobei die natürliche Umgebung um digitale Elemente erweitert werden kann. Es wird also keine komplett künstliche Welt erzeugt, sondern es geht um die Verschmelzung von realer und digitaler Welt. Mixed Reality lässt sich am ehesten als eine Technologie beschreiben, die Virtual- und Augmented-Reality-Elemente kombiniert, um eine nahtlose Interaktion zwischen realer und virtueller Welt zu ermöglichen.
Weiterlesen?
Für alle, die das Morgen schon heute denken.
* Testen Sie uns jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich –
mit Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel und Ausgaben.
Sie sind Abonnent, aber haben noch keinen kein Login? Hier registrieren mit Ihrem Abocode und vollen Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel erhalten.