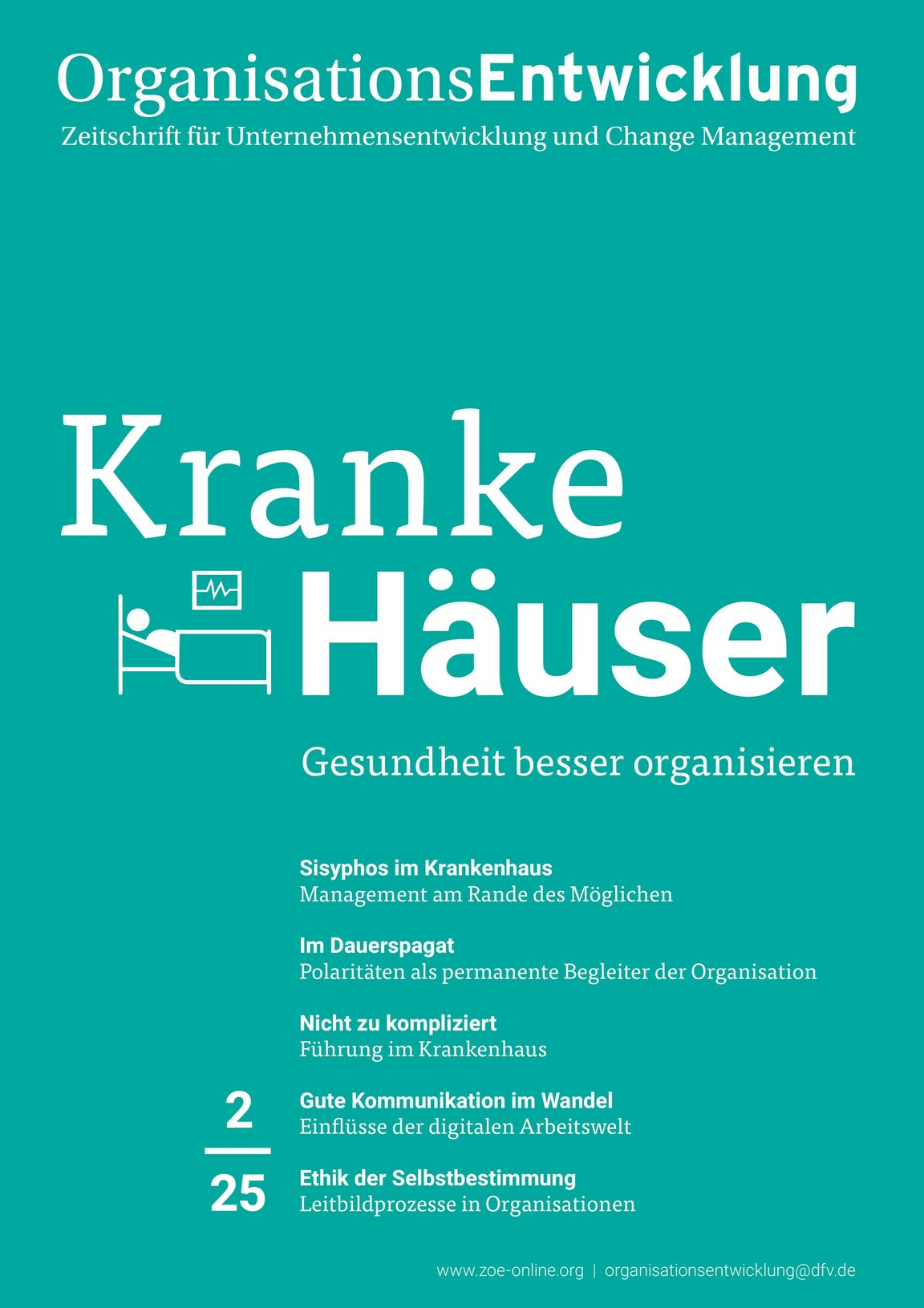«Nachdem wir – zum Glück – allerorts die Möglichkeiten digitaler Medien erkunden, gilt es, diese Bewegung mit einer Auseinandersetzung damit zu koppeln, welche Rolle analogen Räumen im digitalen Zeitalter zukommt und wie diese strukturiert werden müssen.»
Maximilian Locher
Mit Paul Watzlawick und Gregory Bateson lässt sich Kommunikation schon seit den 1960er Jahren in analogere und digitalere Modi der Kommunikation unterscheiden. Je digitaler die Kommunikation, desto nicht-ähnlicher bezieht sie sich auf die Welt. Es werden willkürliche Zeichen genutzt, um die Welt zu bezeichnen, und diese Zeichen über Syntaxen mit eigenen Ordnungen versehen. Auf einmal heißt die säuerlich bis süße, manchmal knackige Frucht «Apfel», und kann durch die Hinzufügung anderer Wörter weiter qualifiziert werden, ohne dass man sie dafür selbst geschmeckt oder gesehen haben muss. Nichts anderes leistet die Sprache. Sie ermöglicht es, Objekte zu bezeichnen, Wissen über die Zeit hinweg zu sichern und jeweils mit klarem sachlichen Bezug Ja oder Nein zu sagen. Ohne diese Form der Digitalisierung der Kommunikation lassen sich «civilized achievements» (Watzlawick et al., 1967) wie der Bau des Empire State Buildings kaum denken. Denn erst durch sie kommen Systeme in einen neuen, nun ungleich komplexeren, Kopplungszusammenhang miteinander. Mit analogen Modi der Kommunikation kann man sich zwar über Ähnlichkeiten auf das damit Bezeichnete beziehen. Die Leistung von Kommunikaten wie Konstruktionszeichnungen, Prozessleitfäden oder Stücklisten können sie aber nicht abbilden.
Weiterlesen?
Für alle, die das Morgen schon heute denken.
* Testen Sie uns jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich –
mit Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel und Ausgaben.
Sie sind Abonnent, aber haben noch keinen kein Login? Hier registrieren mit Ihrem Abocode und vollen Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel erhalten.